Ein außergewöhnlicher Humanist
Vortrag und Musik beschäftigten sich mit Albert Schweitzer
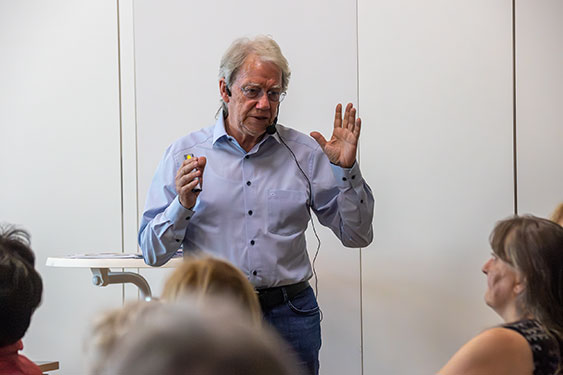 Prof. Dr. Rüdiger Jung bringt den Besuchern des Abends das Leben Albert Schweitzers und dessen Einstellungen zum Leben nahe. Prof. Dr. Rüdiger Jung bringt den Besuchern des Abends das Leben Albert Schweitzers und dessen Einstellungen zum Leben nahe.
In einer Veranstaltung des „Forum Selters“ wurde einer Persönlichkeit gedacht, deren Botschaft zeitlos ist: Albert Schweitzer, der in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag gefeiert hätte. „Gerade heute in dieser verrückten Welt mit Autokraten als Denker und Mahner sollte Schweitzer weiterhin Gültigkeit haben und verbreitet werden“, sagte Volker Hummerich zur Eröffnung der Veranstaltung und traf damit den Gedanken des Abends.
Prof. Dr. Rüdiger Jung widmete seinen Vortrag dem „Mahatma Gandhi der westlichen Welt“. Musikalisch begleitet wurde er dabei von Volker Sievert am Flügel, der den gesamten Vortrag mit Werken Johann Sebastian Bachs, aber auch mit eigenen Kompositionen von Albert Schweitzer bereicherte und so eine Verbindung zwischen Worten und Musik schuf.
 Prof. Dr. Rüdiger Jung bringt den Besuchern des Abends das Leben Albert Schweitzers und dessen Einstellungen zum Leben nahe. Prof. Dr. Rüdiger Jung bringt den Besuchern des Abends das Leben Albert Schweitzers und dessen Einstellungen zum Leben nahe.
Albert Schweitzer wurde 1875 im elsässischen Kaysersberg geboren, als Sohn einer evangelischen Pfarrersfamilie. Schon früh fiel er durch musikalisches Talent auf und entwickelte eine tiefe Liebe zu alten Orgeln. Er studierte Theologie, Philosophie und schließlich auch Medizin – eine ungewöhnliche Verbindung, die ihn zu einer der vielseitigsten Gestalten des 20. Jahrhunderts machte. Doch Schweitzer wollte mehr, als nur in akademischen Zirkeln wirken. „Wer Glück im Leben hat, ist verpflichtet, davon etwas abzugeben an diejenigen, die weniger Glück haben“, lautete einer seiner Leitsätze.
Der Schritt nach Afrika
Getreu diesem Grundsatz reiste er 1913 mit seiner Frau Helene Bresslau nach Gabun. Helene stammte aus großbürgerlichem Hause, war examinierte Lehrerin, hatte in England gearbeitet und erwies sich als ebenso tatkräftig wie ihr Mann. Gemeinsam bauten sie in Lambaréné ein Urwaldhospital auf, das sie gegen alle Widerstände aufrechterhielten. In einfachsten Verhältnissen behandelten sie Kranke, linderten Schmerzen und schufen einen Ort der Hoffnung. Dabei war Schweitzer kein Missionar im klassischen Sinn. Er sah die afrikanischen Menschen nicht als „Objekte westlicher Zivilisation“, sondern begegnete ihnen mit Respekt. Sein Ziel war es, ihre Würde zu achten und medizinische Hilfe zu leisten, ohne ihre Kultur zu missachten.
Aus dieser Haltung heraus entwickelte Schweitzer seinen zentralen Gedanken: die „Ehrfurcht vor dem Leben“. Sie galt nicht nur für Menschen, sondern ebenso für Tiere und die gesamte Natur. Damit nahm er Ideen vorweg, die heute in ökologischen und ethischen Debatten selbstverständlich scheinen, damals aber revolutionär waren.
1952 erhielt er den Friedensnobelpreis. Die Auszeichnung nutzte er nicht für sich, sondern für sein Werk in Lambaréné. Gleichzeitig erhob er seine Stimme gegen Atomwaffen und Militarismus – und wurde so auch zu einem Mahner in den Wirren des Kalten Krieges.
Erinnerung mit Blick in die Zukunft
„Es gibt großen Bedarf, über das Lebenswerk von Schweitzer zu berichten und seine Taten in Erinnerung zu rufen, auch wenn er zurzeit nicht angesagt ist“, unterstrich Rüdiger Jung in seinem Vortrag. Schweitzer sei ein eigensinniger Denker gewesen, unbeirrbar, aber gerade deshalb ein Vorbild.
Der Abend im Stadthaus machte deutlich: Schweitzer ist nicht nur eine Gestalt der Vergangenheit, sondern ein Leitbild für Gegenwart und Zukunft. Sein 150. Geburtstag bietet einen willkommenen Anlass, das Vermächtnis dieses außergewöhnlichen Humanisten neu zu entdecken – im Wort, in der Tat und, wie an diesem Abend eindrucksvoll erlebbar, in der Musik.
|